Ein Buch und seine Geschichten...
Über Hunde und Menschen und die Macht der Liebe

Robbiekomm...


Am Sessel prangt ein feuchter Fleck, unzweifelhaft frisch und ebenso unzweifelhaft von einem Rüden stammend, der das Bein gehoben hat.
Es gibt hier nur einen Rüden und mein wütender Blick nagelt ihn fest.
„Robbie, komm her!“
Robbie erwägt diese Aufforderung. Der Ton gefällt ihm nicht.
„Robbie, komm her! Hierher! Sofort! Aber sofort!!!“
Er erhebt sich mühselig, kommt schwerfällig auf seinen krummen Vorderläufen zu stehen und watschelt, vollständig invalid aber gehorsam, auf mich zu.
„Töle!“ sage ich zwischen den Zähnen. „ Versuch ja nicht mich zu vergackeiern, indem du Quasimodo spielst, du Chaot! Du rennst wie Spurtkurt, wenn’s drauf ankommt, also lass die Faxen! Was ist das hier?“
Und ich deute auf den Fleck.
Er beäugt den Fleck ebenfalls, ist aber offensichtlich nicht der Ansicht, dass er einer Erklärung bedarf, also lässt er freundlich eine tropfende Zunge heraushängen – was mich nicht vergnügter stimmt -und schweigt diplomatisch.
„ Ich werde dir sagen was das ist!“ schnauze ich. „Pfui ist das! Jawohl! Pfui!“
Er dreht den Kopf zur Seite und sieht aus als wolle er sich am liebsten auch in einen feuchten Fleck verwandeln.
Ich bleibe unversöhnlich.
„Hör zu mein Sohn!“ erkläre ich drohend, „ damit keine Missverständnisse aufkommen: wenn hier jemand das Bein hebt, dann bin ich das, verstanden?“
Er blickt skeptisch aber wohlwollend, so als sei er durchaus bereit sich noch weitaus größeren Schwachsinn von mir anzuhören, wenn das bewirkt, dass ich nicht mehr sauer auf ihn bin.
„Streuner!“ sage ich vernichtend und er klopft zaghaft mit dem Schwanz, obgleich die letzte Bemerkung nicht nur menschsgemein sondern auch ausgesprochen ungerecht war, denn sein Streunerdasein hat er sich schließlich weder ausgesucht noch jemals gewollt.
Ich putze an dem Fleck herum, um jegliche Duftmarke wenn möglich unriechbar zu machen, da kommt er an. Das massige Haupt tief gebeugt, so tief es nur geht, - was allerdings bei knapp 30 cm Schulterhöhe nicht allzu tief ist – ein unsäglich erbarmungswürdiges Bild größtmöglicher Reue und Bußfertigkeit, stupst er mich vorsichtig und leise grummelnd an und ich verstehe leider jedes Wort, das er da nicht sagt.
„Tut mir leid“, brubbelt er, „tut mir wirklich furchtbar leid, dass du so sauer bist. Wusste ich doch nicht. Ich dachte, ich bin jetzt hier zu Hause. Ich dachte, das ist jetzt mein Revier und das muss ich doch markieren. Sonst kommt noch einer rein und nimmt es mir wieder weg. Aber ich nehme an, es ist dein Revier. Ich versuch’ dran zu denken. Aber sei wieder gut!“
Er kann es wirklich prima. Er kann es absolut super. Meine Tochter muss ihm Unterricht gegeben haben, in dem „wie –mache- ich –Mama- locker- ein- schlechtes -Gewissen –Fach“. Er könnte sie fast toppen.
„Ist schon gut alter Junge“ sage ich, einem geschmolzenen Käse nicht unähnlich. „Ich hoffe, du findest ein Heim mit einem Riesengarten und einem stabilen Zaun, den du alle 5 cm markieren kannst und der dir ganz allein gehört!“
Ja, antworten seine Augen, Garten und Zaun und Markieren klingt nicht übel, aber ich bin hier auch zufrieden. Man kann nicht alles haben und als Rudelführer bist du ganz in Ordnung auch wenn du überhaupt nicht wie ein Mann riechst. Ich mag dich. Merkst du das nicht?
Und seine tropfende Zunge, die lang wie eine Wetterfahne aus seinem schwarzen Gesicht hängt, schlabbert über meine Füße, liebevoll, demütig und nass.
Ja, denke ich, und dass ich heute wieder eine halbe Stunde auf dich warten musste, weil du stiften gegangen bist, das hast du wohl vergessen.
Er sieht nicht so aus als hätte er es vergessen, ganz im Gegenteil. Es war ein höchst vergnüglicher Ausflug für ihn, den baldigst zu wiederholen sicherlich bereits in seinem Terminkalender rot angestrichen sein dürfte.
Mit ihm spazieren zu gehen ist eine äußerst einseitige Freude. Es gibt nur zwei Alternativen: man behält ihn an der Leine oder man tut es nicht, was in etwa der zwischen erhängen und erschießen entspricht: man ist auf jeden Fall hinterher mausetot.
Hat man ihn an der Leine wird er einem die Arme aus den Gelenken reißen, denn sowie das Tor sich öffnet und der Duft der Freiheit um seine schwarze Nase fächelt, rennt er los. Und er ist ein Bulle. Er ist klein und hat krumme Beine, aber er ist ein kleiner, krummbeiniger Bulle mit der Ausdauer eines Marathonläufers und der Schnelligkeit eines Motorrollers. Ein Greyhound wäre ihm möglicherweise gewachsen – ich bin es auf keinen Fall, nicht mal auf dem Fahrrad, ganz abgesehen davon, dass er mich, rücksichtslos über Stock und Stein und Ackerfurchen rennend, nach maximal 2o Metern aus dem Sattel holen würde.
Erschwerend hinzu kommt, dass er, an der Leine hängend, höchst negative Gefühle gegenüber seinen Artgenossen entwickelt, vor allem gegen die ohne Leine – durchaus verständliche Gefühle der Minderwertigkeit – was in diesem Augenblick aber weder den erschrockenen Besitzern der anderen Hunde noch diesen selbst zufrieden stellend erklärt werden kann, vor allem dann nicht, wenn diese die Kriegserklärung freudig angenommen und ihrerseits zum Angriff geblasen haben.
Lässt man ihn von der Leine rennt er auch los und der einzige Vorteil besteht darin, dass er sich nunmehr nicht im Geringsten für andere Vierbeiner interessiert – nicht mal für die Damen – sondern ausschließlich fürs Rennen.
Mit dem Fahrrad habe ich ihn noch nie eingeholt.
Das erste Mal bin ich noch hinterher gejagt – ein sinn- und hoffnungsloses Unterfangen, denn sowie er spitzgekriegt hatte dass ich ihm hart auf den Fersen war, verfiel er in einen Galopp, der ihm in Hoppegarten zumindest einen Ehrenpreis eingetragen hätte. Er hängte mich mit einer Leichtigkeit ab, für die ich ihm als unbeteiligter Zuschauer sicherlich applaudiert hätte, die mir unter diesen Umständen jedoch lediglich unfromme Verwünschungen über meine Dämlichkeit, dieses unzurechnungsfähige Biest, das ganz offensichtlich mit außerordentlicher Sturheit die nächsten fünf Kilometer weiter bis zur nächsten Hauptverkehrstraße zu rennen gedachte, um sich dortselbst vor einen Autobus zu werfen, von der Leine gelassen zu haben, entlockten. Mein hinter ihm her schallendes Gebrüll spornte ihn offensichtlich zu noch härterer Gangart an und da mir mittlerweile, sowohl ob der ungewohnten Hast wie auch der Angst, das vermaledeite Tier könne zu Schaden kommen, die Luft knapp wurde, stellte ich es ein. Und dann stellte ich die Jagd ein.
Das Ende des langen Feldweges war gekommen und 20 Meter weiter lag die Straße. Irgendein Rest von Instinkt sagte mir, dass eine weitere Verfolgung nicht nur sinnlos war sondern gut und gerne ins Verderben führen konnte – in seines ebenso wie in meines, denn ich war doch für ihn verantwortlich. Und wenn ich auch nicht begriff, warum er vor mir wegrannte, war doch nicht zu übersehen, dass es genau das war, was er tat.
Also blieb ich stehen.
Und er blieb auch stehen.
Er äugte zurück, bereit den Lauf fortzusetzen, falls ich es wünschte. Ich wünschte es nicht.
„Robbie“, sagte ich schnaufend, bereit die Sache zu diskutieren, „Junge komm’ her. Komm’ bloß her! Ich hab’ keine Ahnung, warum du rennst wie ein Blöder, aber hier darfst du nicht weiter! Da vorne ist die Straße. Weißt du was eine Straße ist?“
Natürlich weiß er was eine Straße ist.

Er ist ein Straßenhund, aufgewachsen in den Straßen von Varna am Schwarzen Meer, wo die Verkehrsregeln offenbar ausschließlich die exorbitante Benutzung von Gas und Hupe vorsehen, und dort, im Wilden Süd - Osten, hat er immerhin die ersten drei oder vier Jahre seines Lebens überstanden.
Auf diesen Straßen, Plätzen und Märkten überlebt nur der Schlaueste.
In einer Stadt wo an die 10.000 Straßenhunde Futter suchend herumziehen, sich mit Rentnern und Obdachlosen die Abfalltonnen teilen, wo Rotten schwarz gekleideter Hundefänger mit ihren Würgeschlingen lauern, wo brave Bürger Brotreste mit Strychnin auslegen und wieder andere auf der Suche nach geeigneten Objekten für Hundekämpfe sind, braucht es mehr als Glück um älter als ein Jahr zu werden.
Der Straßenverkehr ist da nur eine von vielen tödlichen Gefahren.

Robbie tauchte irgendwann am Fontänenplatz auf, streunte auf der Einkaufsmeile herum, bettelte vor den Restaurants, bekam Fußtritte, schlief im Gebüsch und erlangte irgendwann, nach einigen Knurrereien und Anfeindungen von Rivalen mit älteren Rechten – die er hartnäckig aussaß – das Recht, sich Dobra zu nähern, der Inhaberin der Imbissbude, um, mit anderen Hunden, aber auch Katzen, an ihren kärglichen Futterspenden teilzuhaben, die überwiegend aus Brot und mageren Küchenabfällen bestanden.
Er lernte zusammengeknülltes Papier zu glätten und die Reste von Schafskäse oder vielleicht auch Wurst, herauszuschlecken. Er lernte, welchen Passanten man hinterherlaufen musste, um darauf zu warten, dass sie etwas fallen ließen und sei es nur dieses zerknüllte Papier. Er lernte, vor welchen Marktständen es sich lohnte zu warten und um welche man besser einen Bogen machte. Er lernte es, genau einzuschätzen, wer zu einem Fußtritt ausholen würde und wer nicht. Er lernte es, Hundefänger schon von weitem zu erkennen und bei ihrem Anblick augenblicklich zu verschwinden. Er lernte Mopeds zu hassen und ihnen rechtzeitig auszuweichen. Und er lernte es, Touristen von allen anderen Zweibeinern zu unterscheiden.
Er lernte zu überleben, von einem Tag zum nächsten.
Dann lernte er das Dreibein kennen.
Normalerweise ging er Dreibeinern vorsichtshalber aus dem Weg, zu schmerzhaft waren die Erfahrungen gewesen, die er mit solchen Drittbeinen, die so unerklärlich jählings geschwungen und äußerst treffsicher eingesetzt werden konnten, schon gemacht hatte. Und er lernte aus seinen Erfahrungen, wiederholte sie selten. Also hielt er Abstand, beobachtete und wartete.
Und begriff ziemlich schnell, dass es sich hier um ein futterspendendes Dreibein handelte und zwar eines, das nicht nur Brot und Abfälle zu bieten hatte, sondern Fleisch und Wurst.
Ein Treffer! Ein Hauptgewinn!
Fleisch auf dem Speiseplan – wann hatte es das jemals gegeben? Nicht mal wenn die Märkte schlossen hatte man eine Chance auch nur die Fleischabfälle zu ergattern; da waren schon die Alten, die Armen, die Obdachlosen zur Stelle und die hatten immer den Vortritt. Wenn man Glück hatte blieben Knochen übrig – und die musste man erst mal erwischen und sich gegen die Rivalen durchsetzen. Gegen Mütter mit Welpen gab es ohnehin keinen Stich zu machen – die hatten das Pré, vorausgesetzt sie waren schnell und groß genug.

Aber das hier – er konnte es nicht glauben! Das Dreibein saß auf einer Bank, jede Menge Tüten um sich herum, aus denen es unaufhörlich Würste und Knochen herauszog – und zwar Knochen, an denen noch Fleisch hing – und verteilte diese ungeheuerlichen Wohltaten an ein Rudel aufgeregt wedelnder Artgenossen, zu denen sich jeden Augenblick mehr gesellten. Er setzte sich in Bewegung, magisch angezogen von den berauschenden Düften die um seine Nase wehten und bewirkten, dass sich seine Körpermitte schmerzhaft zusammenzog, zu einem Gefühl, das er längst zu ignorieren gelernt hatte, weil es immer da war, unabänderlich, ewig, seit seine Mutter aus seinem Leben verschwunden und er ein kleiner Welpe gewesen war: nagender Hunger.
Das Dreibein war weiblich, das roch er; und obwohl die Gerüche die von den Würsten ausgingen ihn fast um den Verstand brachten, nahm er zunächst vorsichtig Witterung auf.
Und dann wurde er bemerkt und dann kam eine Hand von oben und hielt ihm eine Wurst vor die Nase, die größte, die göttlichste, die wunderbarste Wurst die je vor dieser, seiner hungrigen Nase gebaumelt hatte und dann ließ er jede Vorsicht fahren und schnappte zu.
Und rannte weg.

Er wusste nicht woher dieses dreibeinige Futterwunder so urplötzlich gekommen war, aber dass es von nun an täglich etwa zur gleichen Zeit erschien, begriff er schnell. Vom dritten Tag an wartete er bereits, lag geduldig in seinem Gebüsch neben der Imbissbude und ließ den Platz nicht aus den Augen. Wenn dann die Gestalt von Ferne erschien, in einer Hand die verheißungsvollen Tüten tragend, sich mit der anderen auf das dritte Bein stützend, gefolgt von einem weiteren Zweibeiner, ebenfalls mit Tüten beladen, jagte ein Gefühl durch seinen Körper, das er lange vergessen hatte, eines, das Wohlbehagen erweckte und Wärme und Sicherheit, eines, das untrennbar verbunden war mit dem einzigen Wesen das dieses Gefühl jemals in ihm ausgelöst hatte und das nun, transformiert in dieser seltsamen Gestalt mit den drei Beinen, zurückgekehrt war in sein einsames Leben und es aufs Neue mit Nahrung und Liebe umsorgte: die Mutter.
Denn dass da Liebe war und das Bedürfnis zu umsorgen und zu beschützen, das spürte er und obwohl ihm nicht einer der Laute die da gesprochen wurden, vertraut war, vertraute er doch seinem Instinkt, der ihn selten getrogen und deshalb hatte überleben lassen. Hier gab es nichts Böses, keinen Hinterhalt, keine Gefahr, hier gab es nur Schutz und Geborgenheit. Und Nahrung.
Wer anders als die Mutter konnte dies sein?
Wohin gehen wir?
Nach Hause, immer nach Hause.(Novalis)

Und doch waren diese köstlichen Tage begrenzt und auch diese Mutter sollte ihn wieder verlassen.
Der Herbst ging bereits ans Abschiednehmen, als er spürte, dass sich eine Veränderung anbahnte und zwar eine, die Trauer auslöste. Seine wieder gefundene Mutter war traurig, er konnte es spüren, und während ihr Gefährte ihn umarmte und laut in sein Fell schniefte, was er zwar nicht schätzte, aber höflich duldete, begriff er plötzlich, dass sie fortgehen wollte. Einen Augenblick lang war er stocksteif vor Bestürzung, dann wich er zurück, sich aus der lästigen Umarmung lösend, den Blick nicht von der Mutter wendend, den Hals vorgestreckt, die Nase unruhig arbeitend. Sie nahm die Tüten, drehte sie um, schüttelte sie aus, faltete sie zusammen und verstaute sie in ihrer Tasche. Sie breitete die Hände aus, schüttelte sie ebenfalls und sprach in ihren unverständlichen Lauten. Die Laute verstand er nicht, aber er verstand die Gestik, er spürte den Kummer und er roch den Abschied.
Und dann wandte sie sich ab und ging langsam, gestützt auf ihr Drittbein und gefolgt von ihrem Gefährten, die Straße hinunter, die zu den Autobussen führte und er setzte sich auf die Hinterläufe und blickte ihr stumm nach.
Sein Bauch war voll, aber seine Seele spürte Leere und Kälte und Einsamkeit.
Er hatte sie nicht als Reisende erkannt, sonst wäre er vorbereitet gewesen. Reisende kamen und gingen und wenn man das Glück hatte an einen Richtigen zu geraten – denn auch unter Reisenden gab es Gleichgültige und Hundehasser – fielen ein paar Brocken vom Tisch herunter, was einen hungrigen Hund durchaus über den Tag bringen konnte. Aber Reisende kamen nicht Tag für Tag mit vollen Tüten, die nichts als Hundefutter enthielten und fütterten ausgehungerte Tiere. Er konnte nicht wissen, dass dieser Platz mit der Fontäne keineswegs die einzige, sondern nur die letzte von vielen Stationen war, die sie mit ihren vollen Tüten ansteuerte und dass sie dies nicht nur in seiner Stadt sondern auch in einem Ort namens St. Konstantin tat, den er nicht kannte. Er kannte nur Frauen wie Dobra, die selbst nicht viel hatten, aber so gut es ging versuchten einige der „Jauchenköter“, wie man ihn und seinesgleichen nannte, und auch die Straßenkatzen durchzubringen.
Er hatte sie für eine Dobra gehalten, für eine der besonderen Art.
Und das war sie wohl auch.

Der Winter kam und er musste ihn mit leerem Bauch überstehen. Gegen die Kälte schützte ihn sein dicker Pelz, vor dem Verhungern rettete ihn seine Intelligenz. Es war ja nicht sein erster Winter und er wusste noch immer wo die Stellen waren, wo man Fressbares erwarten konnte. Und seine Taktik, geduldig vor einer Bäckerei, Fleischerei oder vor Marktständen zu sitzen, zu warten bis Käufer das Geschäft verließen und sich ihnen dann schwanzwedelnd und mit hängender Zunge in den Weg zu stellen, hatte oft Erfolg. Die Einkaufenden waren ja allesamt Frauen, viele davon weichherzig genug, um einem hungrigen und treu blickenden Vierbeiner ein Stück Brot zuzuwerfen, was sie selten taten, waren die Männer dabei.
Nicht dass er ein besonders hübscher oder putziger Hund gewesen wäre.
Die meisten Menschen fanden ihn ziemlich hässlich. Aber sie fanden ihn einzigartig hässlich und es drückte ihm einen Stempel auf, den er zu Recht trug: er hatte Charakter.
Fast ebenso oft allerdings musste er Tritten ausweichen, was auch nicht immer gelang und schmerzhafte Erfahrungen bescherte, denn es gab durchaus auch Menschen, die ihn nur hässlich fanden, weder einzigartig noch charaktervoll; nur hässlich und lästig außerdem. Davon wusste er nichts, nichts von den seltsamen Schöheitsritualen, die in den Wertvorstellungen der Menschen eine so extrem wichtige und gleichzeitig zerstörerische Rolle spielten und er verstand auch nichts von den Regeln, die den einen Zweibeiner nach ihm treten und den anderen Futter reichen ließ.
Er lebte nur sein Leben, von einem Tag zum nächsten und er versuchte zu überleben.
Es war eine mühselige Wanderung zwischen Leben und Tod, zwischen Hunger haben und verhungern und das quälende Gefühl in seiner Körpermitte war schon lange wieder präsent, ebenso lange wie das warme Wohlbehagen daraus verschwunden war.
Aber er kam durch. Er kam besser durch als die ausgemergelten Hündinnen, die ihre Welpen ernähren mussten, dennoch kaum einen von ihnen am Leben erhielten und sehr häufig auch sich selbst nicht. Manchmal lagen sie am Straßenrand, bis die Ordnungskräfte sie wegwarfen, meistens fand man sie, wenn überhaupt, in den Gebüschen, gemeinsam mit ihren Welpen. Manchmal starben sie vor den Kleinen; dann hörte man stundenlang das leise Jammern der verhungernden Babys, bis eines nach dem anderen verstummte.
Aus irgendeinem Grund, den er auch nicht verstand, hatten die Hündinnen kaum eine Chance gefüttert zu werden, wurden sie eher mit Tritten und Steinwürfen verjagt als ihre männlichen Artgenossen, vor allem dann wenn sie trächtig waren. Das war eines der vielen sonderbaren Eigentümlichkeiten der Zweibeiner die er wahrnahm, dass sie die Mütter nicht hoch schätzten, nicht einmal die ihrer eigenen Art.
Sie waren es doch, die das Leben hervorbrachten, wie konnte man sie verachten, verfolgen, ja töten? Wie die großen Rudel der Zweibeiner unter diesen Umständen überhaupt funktionieren konnten, wenn so grundlegende Prinzipien des sozialen Lebens missachtet wurden, blieb rätselhaft.
Eigentlich waren sie zum Untergang verurteilt.

Im Frühjahr kam sie zurück, die Mutter, und sie kam gerade rechtzeitig um sein Fell zu retten.
Mit dem Eintreffen der ersten Touristen hatte Dobra ihren Imbissstand am Fontänenplatz wieder geöffnet und so hatte auch er sich dort eingefunden, streunte auf der Fußgängerzone herum, bezog vor den Eingängen der Restaurants Stellung und beobachtete die Parkbänke, ob sich jemand kauenderweise darauf niederließ, um dann, in angemessener Entfernung, auf den Hinterläufen sitzend mit tropfender Zunge geduldig zu warten, ob etwas für ihn übrig bleiben würde.
Im Allgemeinen hatte man hier Ruhe vor den Erzfeinden aller bulgarischen Hunde: den Mopeds. Meist war die Einkaufsmeile mit Fußgängern zu sehr bevölkert, als das man sie dort widerspruchslos geduldet hätte. Aber heute war nichts los und das nutzten die jugendlichen Zweibeiner um mit ihren stinkenden und knatternden Rädern auf der leeren Passage eine Rallye zu veranstalten. Sie erwischten ihn als er am Opernhaus vorbeitrabte, sie sehend zu entkommen versuchte um sein rettendes Gebüsch zu erreichen, es aber nicht mehr schaffte. Sie trieben ihn vor sich her, laut johlend, ihre Maschinen auf höchste Drehzahl schmetternd, und als er das Ende des Platzes erreicht hatte tauchte eine weitere Truppe auf und so nahmen sie ihn von zwei Seiten in die Zange. Dies gewahr werdend setzte er sich still auf die Hinterläufe und wartete, während sie einen immer enger werdenden Ring um ihn zogen.
Was sie zu tun vorhatten war ihnen zu diesem Zeitpunkt möglicherweise noch ebenso unklar wie ihm, aber sie erhielten keine Chance mehr es herauszufinden.
Urplötzlich sauste ein Stock auf eine der Lenkstangen, haarscharf vorbei an erschrocken zurückfahrenden Fingern, zuckte dann hoch und bohrte sich mittlings in die Frontseite des Schmählichen, ihn durch energischen Stoß zu Fall bringend, wodurch das hochtourig laufende Gefährt gegen den Nachbarn kippte, was einen überaus gelungenen Domino – Effekt zur Folge hatte, der wiederum einen ungeheuren Tumult auslöste. Plötzlich war der Platz voller Menschen, die den Schauplatz des Desasters umstanden und die nur eine kleine weißhaarige Frau sahen, die ihren Stock gegen eine Horde Jugendlicher schwang, die sie im Kreis, inmitten umgestürzter Mopeds, umstanden, und die aus vollem Halse brüllte. Niemand beachtete den Hund, der sich zusehends verkleinerte, noch kam jemand auf den Gedanken der Klamauk könne seine Ursache darin haben, dass jemand diesen Jauchenköter habe beschützen wollen, sondern man nahm selbstverständlich an, die Attacke der Jugendlichen habe der älteren Frau gegolten und die Reaktion erfolgte entsprechend. Vom Imbissstand eilte Dobra herbei, laut schimpfend, während sich auf der Hauptstraße ein Wagen der Policija näherte und anhielt. Spätestens jetzt hielten die Mopedbuben einen Rückzug für opportun, unterbrachen ihre nutzlosen Verteidigungsreden, griffen nach den Maschinen und verschwanden in knatternd hervorgestoßenen Auspuffgasen.
Glücklicherweise verstand des Hundes dreibeiniger Schutzengel zu wenig von der Landessprache um die tröstend und entrüstet Umstehenden über den tatsächlichen Tathergang aufklären zu können und so blieb es Dobra, die nichts gesehen hatte aber alles wusste, überlassen, die Vertreter der Staatsgewalt über den steigenden Sittenverfall und die gänzliche Verwahrlosung der bulgarischen Jugend umfassend in Kenntnis zu setzen.
Man geleitete die Attackierte fürsorglich zur Bank vor Dobras Imbiss, offerierte ihr einen Anisschnaps, den sie ablehnte und den Dobra trank, und einen Mokka, den sie annahm, während ihr Gefährte, der plötzlich von Gott-weiß-woher auftauchte, verheißungsvolle Tüten neben der Bank deponierte.
Robbie hatte die ganze Zeit bewegungslos auf einem Fleck gesessen; es schien das Sicherste zu sein. Auch zollte ihm niemand Beachtung und er hatte gelernt auch dies als das Sicherste anzusehen. Aber er begriff durchaus, was sich hier gerade abgespielt hatte, denn eines hatte er nie lernen müssen, weil er es von Geburt an wusste:
Leg dich nie mit einer Hündin an, die Welpen beschützt! Leg dich am besten überhaupt nie mit einer Hündin an, auf gar keinen Fall jedoch mit einem Muttertier, außer du bist lebensmüde!
Die zweibeinigen Junghunde, die da auf ihn losgegangen waren, hatten diese elementare Regel verletzt, es schien fast, als kennten sie sie nicht einmal! Andererseits hatten sie natürlich auch keine Ahnung gehabt, in welch unmittelbarer Nähe sich die Mutter des „Welpen“ – nämlich er - befand den sie angegriffen hatten, wenn dies auch nicht die Würdelosigkeit entschuldigte, die sie einen Wehrlosen attackieren ließ.
Aber was die Ahnungslosigkeit anbetraf: auch er hatte nicht gespürt, wie nah sie war und seine Überraschung ließ sich mit der seiner Peiniger durchaus vergleichen, zumindest was den Umfang anging.
Für seine Gefühle gab es nichts Vergleichbares.

Und dann rief sie ihn, wieder in diesen unverständlichen Geräuschen, die sich inzwischen jedoch – weil sie sie immer und immer wiederholte – zu einer erkennbaren Melodie formten, aus der sich eine Kadenz deutlich herausschälte:
„Robbie!“ rief sie. „Robbie! Robbie, komm, komm her!
Komm, Robbie, komm!“
Und dann verstand er, dass dies sein Name war.
Robbiekomm.

Als Rosi mich anrief, war ich in erster Linie erleichtert dass sie dies aus Bulgarien tat; das hieß, sie musste sich auf das Wesentliche beschränken statt mich in epischer Gründlichkeit über den Neuwuchs jedes Grashalmes in St. Konstantin zu informieren. Andererseits war klar, dass sie dies nicht nur des Schwatzens wegen tat, sondern einen triftigen Grund haben musste, der mit Sicherheit vier Beine haben würde.
Ich hatte noch nicht einmal die Chance mein „wie geht’s dir denn“ vollständig loszuwerden, da war sie schon mitten in der Geschichte:
„...und dann ham’ ihn diese Halbstarken mit ihren Mopeds umzingelt, richtich umzingelt, sage ich dir und der arme kleine Kerl, da saß er und wusste nich’ weiter und hat jezittert und er saß da immer bei Dobra im Gebüsch und hat auf Banitza gewartet und der war schon immer im Herbst da, immer im Gebüsch, da ist so ein großer Platz und auf der Bank vor Dobra, da sitzen wir immer und füttern die armen Hunde und dann komme ich grade richtig und seh’ die Lümmels und dann bin ich dazwischen, was meinst du wohl, mit dem Stock bin ich dazwischen und prostak! hab ich gerufen und glupak newaspitan! und einen habe ich runtergestoßen und da sind die anderen auch umgefallen und was meinst du wohl wie sie Fersengeld gegeben haben, die Samochvolko, so habe ich sie auch genannt, aber dann hat Dobra gesagt, dass die zurückkommen werden um ihm was anzutun, weil sie sich seinetwegen blamiert haben und dann konnte ich ihn doch nicht da lassen....“
„Wer ist Banitza?“ wollte ich wissen, nach einem roten Faden angelnd, um den Ein- oder Ausgang der Story zu finden.
„Das ist ein Brot. Mit Schafskäse. Dobra verkauft das und wenn sie Reste hat dann gibt sie es den Tieren und darum...“
„Rosi!“ Ich unterbrach sie rüde aber entschlossen. „Komm zum Punkt! Worum geht’s und wo ist der Hund jetzt?“
„ Bei mir. Also... bei Toni... aber da kann er ja nicht bleiben und das ist ja auch nicht sein Revier und da dachte ich ... meinst du, ich kann ihn mitbringen?“
Diese Frage hörte ich nicht zum ersten- und mit Sicherheit auch nicht zum letzten Mal. Ich verstand auch, wie schwer es für sie sein musste. Wie viele ihrer Schützlinge, denen sie im Herbst die Bäuche gefüllt hatte, waren im Frühjahr noch da? Nur wenige überlebten den harten Winter und die Schießübungen der jagdfreudigen Bulgaren. Nur wenige, aber immer noch zu viele um den Kreislauf der unablässigen Vermehrungen durchbrechen zu können. Ich verstand durchaus, dass sie wenigstens einen von diesen erbarmungswürdigen Seelen endgültig retten wollte, ihn für immer herausziehen aus dieser Hölle für Tiere.
Nur - wohin?
Ich hatte zwei Hunde, sie einen (selbstverständlich ein Bulgare), alle Leute die ich kannte, hatten mindestens einen, meistens sogar zwei oder mehr Hunde. Alle mir bekannten Boote waren voll. Sie redete schon hektisch weiter.
„Er kann ja erst mal bei mir bleiben...bloß... du weißt doch, der Stasi-Spitzel... und wenn’s länger dauert dann macht er mir Ärger, er wollte doch Mon Cheri (noch ein Bulgare) auch schon vergiften (war mir neu), weil der immer durch seinen Zaun durch wollte (ach so), bloß Goldie, den haben alle gern, (ist auch ein Goldschatz) da guckt die Alte (Gattin des Stasi-Spitzels) immer übern Zaun und schäkert, so als ob sie Hunde leiden könnte, kann sie aber nicht, ist alles bloß“ - und dann riss die Leitung.
Es würde ungefähr zehn Minuten dauern, bis sie ausreichend Kleingeld zusammengeklaubt hatte um erneut anrufen zu können, Zeit genug also um mir zu überlegen, welche Möglichkeiten es gab einen weiteren bulgarischen Schiffbrüchigen aus der tosenden See zu fischen. Ich kannte die Situation da unten viel zu gut um nicht zu wissen, dass ihr das Herz brechen würde, müsste sie ihn zurücklassen. Und dafür waren Herzen wie das ihre zu schade, gar nicht zu reden davon, dass ich monatelang ihre Ängste und Befürchtungen und ihr schlechtes Gewissen auszuhalten hätte. Zu tief saß ihre Angst noch einmal etwas Ähnliches wie mit Goldie erleben zu müssen – meine übrigens auch.

Der kleine Wuschel mit dem goldfarbenen Pelz war ihr im Herbst 1999 in St.Konstantin über den Weg gelaufen, freundlich, liebebedürftig, hungrig, und in einem, selbst für bulgarische Verhältnisse, ungewöhnlichen Maße zutraulich. Er war kein wirklicher Streuner sondern suchte einen Platz im Leben eines Zweibeiners und dies mit großer Hartnäckigkeit. Sie schlossen sich gegenseitig ins Herz und da kurz zuvor ihre alte Hündin gestorben war, entschloss sie sich ihn mitzunehmen.
Zwei Tage vor dem Abflug verschwand er und war nicht aufzufinden; da sie die Ausreisepapiere hatte griff sie sich kurzerhand einen anderen ihrer vierbeinigen Gefolgsleute – unglücklicherweise war es keiner, der zu ihr gepasst hätte, so wenig wie sein Name zu ihm passte: Mon Cheri.
(Ich nannte ihn Monschie...)
Er war ein Streuner, souverän, selbstbewusst, intelligent und freiheitsliebend, aber auch freundlich und geduldig genug, sich ein Geschirr umlegen und in eine Transportkiste verfrachten zu lassen. Ebenso geduldig lief er an der Leine neben Rosi einher, sich ihrer langsamen Gangart notgedrungen anpassend; aber ließ man ihn von dieser Leine verschwand er blitzartig, so dass von weiteren Versuchen dieser Art abgesehen werden musste.
Er war nicht glücklich, auch wenn Rosi hartnäckig das Gegenteil behauptete.
Letztendlich ließ sie sich jedoch überzeugen und ich brachte ihn nach Hessen, wo er bei einer Pastorenfamilie einzog, die daraufhin im Eiltempo daranging ihren großen Garten ausbruchsicher zu machen. Es half nicht allzu viel, denn er fand immer eine Möglichkeit hinaus zu kommen; aber da man ihn in der kleinen Gemeinde bald kannte und als „Pastors Stromer“ tolerierte, er wiederum nach seinen Spaziergängen - die ihn durch den Ort zu verschiedenen Metzgereien und Feinkostläden führten - stets zurückkam, war dies kein Malheur. Eigentlich führte er genau das Leben an das er gewöhnt war, nur dass er jetzt ein Zuhause hatte, wo ein voller Fressnapf und ein gemütlicher Schlafkorb auf ihn warteten.
Und er bekam auch einen passenderen Namen. (Der mir aber nicht mehr einfällt; für mich blieb er Monschie)
Und während all dieser Zeit hatte Rosi nicht aufgehört von dem kleinen, goldfarbenen Rüden zu erzählen. Sie machte sich große Sorgen um ihn und Vorwürfe, nicht intensiver nach ihm gesucht zu haben.
Im Frühjahr flog sie wieder hinunter und als ich sie zum Flugplatz brachte, war sie fast außer sich. „Ihm ist was passiert!“ sagte sie immer wieder. „Ich hab’s geträumt, man hat ihm was angetan! Ach Gottchen, warum hab’ ich ihn bloß nicht mitgebracht, ich hätte ihn suchen müssen, er wollte doch mit mir mit! Wenn ich bloß noch rechtzeitig komme, wenn’s bloß noch nicht zu spät ist!“
Nach meiner Meinung war die Aussicht den Hund lebend wieder zu finden ohnehin nicht allzu groß, aber das sagte ich ihr nicht.
„Du hast zwei Wochen Zeit ihn zu suchen“, meinte ich beruhigend. „Und wenn du ihn findest, dann bring ihn mit und alles ist fein!“
„Die haben ihm was getan“, murmelte sie. „Ich hab’ ihn schreien hören. Ach Gott, wenn er bloß noch lebt, wenn ich ihn bloß finde!“
Zwei Tage später rief sie an um mir zu sagen, dass sie ihn gefunden hatte.
„Sie haben ihn angeschossen“, sagte sie. „Muss genau an dem Tag passiert sein, als ich davon geträumt habe. Er hat ein Auge verloren, aber er wird es schaffen. Der Tierarzt sagt, es war eine Gaspistole, aus nächster Nähe. Er war einfach so zutraulich, ist zu jedem hingegangen und jetzt hat ihm einer“ - und ihre Stimme brach.
„Er wird wieder“, sagte sie dann. „Das andere Auge wird er behalten. Er sieht furchtbar aus, aber das kriege ich hin. Pflege und Futter, dann wird er wieder. Ich bin zur Toni gezogen, aus dem Hotel haben sie uns rausgeschmissen, weil ich den Hund mit rein genommen habe, ist egal, diese Hundehasser, sollen sie mir den Buckel runterrutschen; bei Toni geht’s uns auch gut, ist sogar billiger. Er wird wieder. Ich bring ihn mit. Hätte ich bloß länger gesucht! Hätte ich doch bloß länger gesucht!“
Ich schaltete das Telefon aus, behielt es in der Hand und glotzte es an.
Welche Antenne hatte diese Frau ausgefahren, dass der Hilfeschrei einer gequälten Kreatur über Zeit und Raum hinweg von ihr aufgefangen werden konnte? Und welches Band gab es zwischen ihnen, dass er in seiner Not nach ihr rief, nach ihr, die sie mit Tüten beladen umher zog, um viele hungrige Mäuler zu stopfen, nicht nur das seine? Hatte er gespürt, dass es da ein Versprechen gab, dass sie ihn hatte mitnehmen wollen, dass er zu ihr gehören sollte, dass sie ständig an ihn dachte?
Welche andere Erklärung konnte es geben?
Keine die mit dem Verstand zu begründen war.
Er hatte nach ihr gerufen und sie hatte ihn gehört.
Sie war zu spät gekommen um sein Leid zu verhindern; aber nicht zu spät um sein Leben zu retten. Er gehörte zu ihr.


Als ich ihn sah, brach ich in Tränen aus.
Da kam er durch die Abfertigung, brav an seiner Leine trabend, ein kleiner, magerer Hund, mit dichtem, goldbraunem Fell und großen, puscheligen Ohren; als ich mich niederhockte kam er sofort und schaute mit einem großen, braunen, schwarzumrandeten Auge ohne Arg zu mir auf. Das andere war hell und milchig und blind, das Fell drumherum wie angesengt. Er musste entsetzliche Schmerzen ausgehalten haben, und doch kam er ohne Anzeichen von Angst oder auch nur Zurückhaltung auf mich zu und wedelte mich schüchtern an, so als könnte er die grausame Lehre die man ihm erteilt hatte, nicht mit dem Tun eines Menschen in Zusammenhang bringen.
Vielleicht wäre er seinem speziellen Peiniger künftig ausgewichen; aber jedem anderen hätte er sich weiterhin ausgeliefert und früher oder später wäre dies sein Todesurteil gewesen. Er gehörte zu jenen Seelen, die ausschließlich zu Liebe und Vertrauen fähig sind; über das Quäntchen gesundes Misstrauen, dass manchmal über Leben und Tod entscheidet, verfügte er nicht, und das machte ihn zu einem klassischen Opfer für jeden der kranken Sadisten, deren Wohlbefinden einzig von der Willkür abhängig zu sein scheint, die sie gefahrlos über Schwächere ausüben können.
Möge Gott ihnen gnädig sein.
Ich kann es nicht.

Noch bevor Rosi wieder anrief, war mir klar, dass sie den Hund mitbringen würde, so oder so.
Die Worte „ wer auch nur ein einziges Leben rettet, der rettet die Welt“, schienen ihr Sein zu bestimmen und sie war offenbar eisern entschlossen die Welt wieder und wieder zu retten, ob sie wollte oder nicht.
Also war es wohl zweckdienlich sich ein paar Gedanken zu machen, was, nach erfolgter Rettung, passieren sollte – nicht mit der Welt. Nur mit dem Hund.
Da ich um ihre Eigenart wusste, ein unterbrochenes Gespräch punktgenau fortsetzen zu können und nicht begierig war noch ausführlicher über den miesen Charakter der Stasibraut informiert zu werden, statt sachliche Informationen zu erhalten, bremste ich sie sofort aus, kaum dass ich den Hörer am Ohr hatte.
Der Hund sei nicht sehr groß, erfuhr ich. Etwa so wie Mon Cheri. Eigentlich war er überhaupt so ähnlich wie Mon Cheri; und ich stöhnte innerlich auf. Wenn er auch nur annähernd so war wie Monschie, dann standen uns wieder anstrengende Tage bevor.
„Er ist ’n ganz Ruhiger,“ beschwichtigte sie meine unausgesprochenen Bedenken, was diese keineswegs zum Abklingen brachte, denn auch Monschie war ein ganz Ruhiger gewesen: in der Wohnung vollständig pflegeleicht, kein Kläffer und auch keiner, der von Vaters Pantoffeln bis zum Esszimmertisch alles zerlegte; auch stubenrein von Anfang an.
Aber er konnte dem Ruf der Freiheit nicht widerstehen und ein Hund der bei jeder sich bietenden Gelegenheit nur eine Staubwolke hinter sich lässt, ist Gift für eines jeden Hundehalters Seelenfrieden.
Andererseits hatte er einfach umwerfend ausgesehen; ein Salz-und-Pfeffer-Schnauzer-Verschnitt, mit riesigen Stehohren, einer sehenswerten buschigen Ringelrute und einem Backenbart der unseren alten Kaiser Wilhelm vor Neid grün gemacht hätte.
„Kastriert ist er auch schon“, kam es hoffnungsvoll durch die Leitung. „Auch schon geimpft, alles fix und fertig!“ „Ich nehme an, du hast auch bereits alle Ausreisepapiere?!“ Selbstverständlich hatte sie die, ebenso wie eine Transportbox, denn Bagatellen werden Rosi niemals aufhalten.
„Also dann hast du ja bereits alles geregelt, bis auf die Kleinigkeit was mit ihm passieren soll!“
„Ja.“
„ ????“
„Also, ich meine, ich nehme ihn natürlich erst mal. Natürlich. Und er ist doch so ein braver und lieber Kerl, auch nicht so groß und kastriert, für den müssten wir doch bald jemand finden, meinst du nicht?“
„Nein, meine ich nicht. Rosi, die Urlaubssaison steht erst bevor, da werden Hunde ausgesetzt und nicht neu vermittelt! Aber ich werde mich mit Märkisch Buchholz in Verbindung setzen. Vielleicht haben sie noch Platz für einen kleinen, lieben, braven, ruhigen und kastrierten Musterknaben. Seine Chancen vermittelt zu werden sind von dort aus wesentlich besser als wenn er bei dir ist. Und ich halte nicht allzu viel davon, dass du dich von zwei Hunden durch die Gegend ziehen lässt!“
„Kein Hund“, bemerkte sie mit Würde, „zieht mich durch die Gegend! Aber der Stasi-Spitzel... der spioniert doch bloß wieder...vielleicht macht er mir Ärger und schwärzt mich an, wenn er die Hunde vorher so reizt, dass sie ihn ankläffen...du weißt doch...“
Für Rosi ist die DDR noch sehr lebendig.

Märkisch Buchholz, das kleine Tierheim in den Brandenburgischen Wäldern, erklärte sich bereit den Hund aufzunehmen. Sie fielen mir nicht gerade um den Hals vor Freude, denn es herrschte kein Mangel an Hunden, und, wie schon richtig festgestellt, stand die Urlaubssaison noch bevor, aber sie waren bereit zu helfen.
Also stand ich am 18.Mai 2002, mit Annett vom Tierheim, am Flughafen Schönefeld, um Rosi und ihren Asylanten willkommen zu heißen.
„Weißt du wie er aussieht?“ fragte sie mich.
„Nein, nicht genau. Sie sagt er ist wie Mon Cheri und der war bildhübsch, aber damit meint sie vielleicht nur seine inneren Werte. Ich glaube ihr ist es ganz egal wie so ein Hund aussieht.“
„Da hat sie ja wohl auch ganz Recht“, meinte Annett. „Hauptsache, er ist nicht schwarz. Schwarze Hunde sitzen bei uns ewig, aber frag’ mich nicht warum.“
Vielleicht, weil schwarze Hunde eine der Masken des Teufels auf Erden sind?
Ich drückte mir die Nase an der Scheibe zur Ankunftshalle platt, die sich allmählich mit heimkehrenden Urlaubern füllte und spähte nach Rosi. Zu allererst sah ich die Transportbox, konnte aber nicht erkennen wer oder was sich darin befand. Dann erschien Rosi, wie üblich mit Tüten behängt, gefolgt von ihrem Gefährten Klaus, und steuerte auf die Box zu, sich mit ihrer Gehhilfe, die sie wie eine Wünschelrute nach vorn streckte, energisch ihren Weg bahnend. Eine kurze Bewegung mit der Krücke und Klaus ging in die Knie um die Box zu öffnen und ihren Insassen in die Freiheit zu entlassen.
Heraus kam Quasimodo.

Ich traute meinen Augen nicht.
Rosi konnte tatsächlich nur seine inneren Qualitäten gemeint haben als sie ihn mit Mon Cheri verglichen hatte, denn äußerlich hatte er allenfalls die Größe mit ihm gemeinsam.
Irgendein himmlischer Spaßvogel musste die Gene eines Groenendaels, eines Bassetts und eines Leguans in einen Mixer geworfen und anschließend auf Stufe drei gedrückt haben.
Der Kopf mit dem langen Fang, aus dem eine lange, rote und augenscheinlich tropfende Zunge heraushing, saß auf einem massigen Hals, der es vollständig verschmähte sich an den kurzen Rumpf anzupassen, der wiederum auf vier krummen Beinchen ruhte, von denen die vorderen nicht nur kürzer als die hinteren waren sondern auch noch eindeutig x-förmig auseinander strebten. An den Seiten seines beeindruckenden Schädels flatterten ein paar lächerliche Knickohren, die selbst einem sehr viel kleineren Hund peinlich gewesen wären; einzig seine kräftige Rute verhieß etwas Respektabilität.
Aber seine wachen Augen verrieten Intelligenz, Geduld und große Würde.
Außerdem war er schwarz wie die Nacht.
Ich liebte ihn sofort.
Er krabbelte etwas mühselig aus der Box, in der er so lange Stunden eingezwängt und die eindeutig zu klein für ihn gewesen war, schüttelte sich, äugte in die Runde, fand sie offenbar nicht weiter bemerkenswert und ließ sich mit großer Ruhe anleinen. Auf dem Weg zum Ausgang hob er das Bein und setzte seine erste Reviermarkierung auf deutschem Boden.
Ich schlich zu Annett zurück, die vor der Zollabfertigung wartete. Sie warf mir einen kurzen Blick zu und nickte.
„Schwarz?“
„Rabenschwarz!“
„Und weiter?“
„Eine lange rote Zunge!“
„Und weiter?“
„Wart’s ab!“
Und dann glitten die Schiebetüren auseinander und Rosi spazierte heraus, Quasimodo vorneweg und Klaus, den Gepäckwagen schiebend, angemessene zwei Schritte hinter ihr.
„Ach ist der Plüsch!“
Das kam von Annett und hatte ich vorher meinen Augen nicht getraut, waren es nunmehr die Ohren. „Plüsch“ das hieß in der Übersetzung soviel wie: süß und niedlich, entzückend und reizend, was wiederum, wenn ich das „Buch des treffenden Wortes“ zu Rate ziehe, nichts anderes bedeutet als: hübsch, lieblich, anziehend, wohlgestaltet, bestrickend, charmant und fein, alles Benennungen, die mir zur Charakterisierung dieses Vierbeiners so ziemlich als letztes, genauer gesagt, überhaupt nicht, in den Sinn gekommen wären.
Aber da hockte sie schon vor ihm, der da auf den Hinterläufen saß, die Zunge heraushängen ließ und sie mit Wohlwollen betrachtete, und hieß ihn willkommen, während Rosi sie mit gewohnter Ausführlichkeit über sein Schicksal, seinen Namen, seine Gewohnheiten, Dobras Imbissstand, die Hundehasser von St. Konstantin allgemein, sowie des Hotels Ranitza im Besonderen, die besten Einkaufsmöglichkeiten für Hundefutter und Wurmtabletten in Varna, den Stasi-Spitzel im Nachbargarten, die Leiden ihres Hundes Goldie und die von etwa zwanzig anderen, die sie alle namentlich benannte, informierte.
Sie redete noch als Robbie es sich bereits in Annetts Auto bequem gemacht und diese zielstrebig den Zündschlüssel umgedreht hatte, sanft darauf hinweisend, dass sie im Tierheim erwartet werde und eine Stunde Fahrt vor sich habe.
Da trat sie zurück und schluckte kurz.
Ich nahm sie am Arm und schob sie zu meinem Auto, ihr tröstend erklärend, dass sie nun alles getan habe und den Rest getrost dem Tierheim überlassen könne.
Sie wischte sich die müden Augen.
„Wenn er bloß nicht so lange da sitzen muss. Er ist doch nicht gewöhnt eingesperrt zu sein!“ „Nein, aber regelmäßig gefüttert zu werden ist er auch nicht gewöhnt und vielleicht entschädigt ihn das ein bisschen! Und Annett hat versprochen, dass er in das große Gehege kommt. Da ist er mit anderen Hunden zusammen und das wird ihm gefallen. Er wird nicht in einem kleinen Zwinger sitzen, also mach dir keine Sorgen!“
Es war nur gut, dass Rosi den abendlichen Anruf von Annett nicht mitbekam, denn dann hätte sie meiner Versicherung, dass kein Anlass zu Sorgen bestand, wohl kaum noch Glauben geschenkt.
„Der Bursche kann klettern!“
„Er kann was?!“
„Er klettert wie ein Kragenbär!“
„Und das hast du gesehen?“
„Nein, habe ich nicht, keiner hat’s gesehen, aber er muss geklettert sein, anders war kein Rauskommen...“
„Drunter durch? Loch im Zaun?“
„Weder noch. Alles überprüft. Er muss oben rüber gekommen sein und jetzt sind natürlich die Knödel am Dampfen. Dabei hat es so gut ausgesehen! Er hat sich während der Autofahrt kein bisschen gemuckst, war ganz vorbildlich, ist ganz brav ins Tierheim mit rein und hat sich in den großen Auslauf bringen lassen. Da gab’s dann ein bisschen Gebrumme mit den anderen, aber er hat sich ganz cool durchgesetzt und ich dachte alles ist Super. Dann sitzen wir beim Mittagessen und ich erzähle den anderen von ihm und dass ich ihn für einen ganz tollen Hecht halte, da fragt mich die Azubi ob ich den meine, der da hinter meinem Stuhl sitzt! Ich dreh’ mich um und da sitzt er doch tatsächlich, lässt die Zunge raushängen und klopft mit dem Schwanz! Dann sind erstmal alle hektisch los und haben nach Löchern und Ritzen im Zaun gesucht, aber nichts. Dann haben wir ihn in einen kleineren Zwinger gesetzt, zu einem jüngeren Rüden. Kaum war er drin, hat er schon die Höhe ausgemessen und war in Nullkommanichts wieder draußen. Hat auch keiner gesehen, aber plötzlich ist er durch die Küche spaziert. Er muss rüber geklettert sein und jetzt können wir ihn natürlich nicht da lassen, denn kommt er über den einen Zweimeterzaun, kommt er auch über den Außenzaun und zeigt womöglich noch den anderen wie’s geht.“
„Aber er hat doch gar nicht versucht abzuhauen, oder?“
„Nein“, gibt sie zu, „hat er nicht. Er wollte bei mir sitzen, nicht im Käfig. Aber ich kann ihn nicht mitnehmen, so gern ich’s täte! Mein Mann hat mit Scheidung gedroht und meine Tochter mit sofortigem Auszug, wenn ich ohne zwingenden Grund wieder einen Hund anschleppe! Und über zwingende Gründe haben sie andere Ansichten als ich. Fürs erste nimmt ihn Maria mit, weil wir zurzeit keinen Zwinger frei haben, der oben zu ist. Aber sobald das der Fall ist muss er da rein, hilft nichts!“
Ich stöhnte, denn so sehr ich seine Beharrlichkeit bewunderte verdammte sie ihn doch letztendlich zu genau dem Schicksal, das Rosi befürchtet hatte. Ich tröstete mich damit, dass er ja schließlich nicht den Rest seines Lebens dort verbringen sollte, sondern nur eine kurze Zeit, bis zur Vermittlung, die doch hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten lassen würde.
In meinem Hinterkopf hörte ich Annett sagen: „Schwarze Hunde sitzen bei uns ewig, frag’ mich nicht warum!“ Und dann hatte ich sie vor Augen, die schwarzen Hunde, die in Märkisch Buchholz schon ewig saßen: Sheela aus Rumänien, das schielende Unikum, das fast ein Jahr auf ein neues Zuhause warten musste ...oder Joker, der schwarze Schäferhund, der irgendwann so massive Verhaltensstörungen zeigte, dass Annett ihn kurzerhand mit nach Hause nahm. (Natürlich nur vorübergehend und natürlich ist er immer noch da.)
Und die Urlaubssaison hatte noch nicht mal angefangen...
Zwei Wochen später holte ich ihn wieder heraus.
Ich war hingefahren um mit ihm Gassi zu gehen. Er saß allein in seinem Zwinger, links daneben ein Rüde der ihn nicht leiden konnte und es lautstark bewies, rechts daneben einer den er nicht schätzte, was das nämliche Resultat ergab, vor sich ein tiefes Loch, durch das er wohl versucht hatte sich in die Freiheit zu graben, bis er die Aussichtslosigkeit seines Tuns erkannt und es aufgegeben hatte. Es gab kein Entkommen, der Zwinger war dicht, oben zu, unten zu und an den Seiten sowieso.
Als ich ging, saß er in der für ihn typischen Haltung auf den Hinterläufen, die deformierten Vorderläufe gespreizt, die Zunge heraushängend, geduldig durch das Gitter schauend, harrend, auf was auch immer.
Es war nicht auszuhalten.
Ich marschierte ins Büro um kundzutun, dass ich ihn mitnehmen würde. Niemand erhob Einwände; man versprach ein Bild von ihm aufzuhängen und ihn außerdem auf die Homepage zu setzen, um seine Vermittlungschancen zu erhöhen.
Aber die Zwinger waren voll, noch dazu mit eindeutig hübscheren Hunden.
Und die Urlaubssaison hatte noch nicht mal angefangen.

Da standen wir also auf dem Feldweg, ich schnaufend, er hechelnd, während meine beiden Hündinnen, weit abgeschlagen, gerade noch zu sehen waren.
„Robbie“, sagte ich, bereit zu diskutieren, „da vorne ist die Straße. Weißt du was eine Straße ist?“
Er weiß was eine Straße ist.
Er war einst ein Straßenhund, damals, in einer Welt die ihm vertraut gewesen war, in einem Leben, das er nur so und nicht anders kennen gelernt hatte, in Straßen die er kannte, mit Gefahren, denen auszuweichen er gelernt hatte, mit Geräuschen und Gerüchen, die Orientierung boten und damit ein Stückchen Sicherheit, all das was auch für Menschen bedeutet zu Hause zu sein.
All dies war verschwunden und das einzige was man ihm dafür gegeben hatte waren unablässig wechselnde Zweibeiner: erst Rosi, dann Annett, Maria und nun ich. Und er rannte wohl, weil er auf der Suche war, hinter jedem nächsten Baum, jeder kommenden Wegbiegung Vertrautes zu finden hoffte, ein Stück Heimat, dass ihm helfen konnte, sein verrutschtes Leben wieder gerade zu rücken.
Aber er fand nichts, außer dass ich brüllend mit dem Fahrrad hinter ihm her raste, was vielleicht Erinnerungen an Moped-Hetzjagden in ihm wachrief, wenn ich es auch nicht hoffen will.
Ich stieg vom Rad und setzte mich auf die Erde, auf meine Hündinnen wartend, die, etwa 100 Meter entfernt, gemächlich herantrotteten, während Robbie seine klassische Pose – auf die Hinterläufe, Zunge raus – einnahm und sich geduldig meinen Vortrag anhörte.
„Robbie“, sprach ich, „ wie müssen uns einigen. Zunächst einmal: du musst gehorchen! Du bist ein Hund und Hunde müssen gehorchen!“
Er riss den Fang auf um zu gähnen, klappte ihn wieder zu, ließ die Zunge noch ein Stück weiter heraushängen und hechelte geräuschvoll und ich hatte das dumme Gefühl, dass er sich totlachte.
„Also,“ sagte ich, „ ich weiß nicht, ob du jemals in deinem Leben so etwas wie einen Herrn hattest und genau genommen weiß ich nicht mal, ob es in diesem Zusammenhang so etwas wie ein weibliches Äquivalent zu ,Herr’ gibt, was auch völlig Wurscht ist, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass ihr Hunde von den Wölfen abstammt und bei denen wiederum ist die Rangordnung stur geregelt! Da gibt es jemanden der ,Alpha’ heißt und wer so heißt der hat das Knurren im Rudel! Und warum? Weil er dafür sorgt dass der Rest zu fressen hat, darum! Und wer gibt dir zu fressen? Häh?“
Das Wort ,fressen’ hat er verstanden und es gibt ihm offenbar zu denken. Die Zunge verschwindet und leckt die Lefzen, dann steht er auf und watschelt ein paar Schritte näher.
Hinterläufe, Zunge wieder raus.
Er ist ganz Ohr.
„Du bist ein verdammt schlauer Bursche, “ sage ich bewundernd, „ und einen Besitzer für dich zu finden, der dir geistig gewachsen ist könnte ein weiteres Problem werden, abgesehen von denen die es ohnehin schon gibt. Aber wenn die Schwierigkeiten nicht unüberwindbar sein sollen, wirst du wohl ein paar Regeln lernen müssen, ob es dir passt oder nicht.
Erstens: du folgst mir und nicht umgekehrt.
Zweitens: du kommst, wenn ich dich rufe.
Drittens: das Durchstöbern von fremden Gärten mag lustvoll sein, ist aber verboten und Löcher in den Zäunen sind nicht als Einladung zu verstehen das dahinter liegende Gelände zu erkunden. Siehe Paragraph 2.
Und um dir die Befolgung dieser Grundsätze zu erleichtern, kommst du jetzt an die Leine, so lange bis wir diese gefährliche Zone umschifft haben!“
Er ist schneller auf den Beinen als ich „Papp“ sagen kann, wirft sich herum und verschwindet mit Höchstgeschwindigkeit im Dickicht.
Offenbar ist er nicht geneigt, einen neuen Besitzer auch nur in Erwägung zu ziehen.
Und darum musste ich eine halbe Stunde sitzen bleiben und darauf warten, dass er wieder auftauchte, was er irgendwann tatsächlich auch tat.

Fünf Wochen später rief Annett an.
„Geht’s gut?“ fragte sie.
„Kommt drauf an wen du meinst!“ gab ich zurück. „Wenn du Robbie meinst, dem geht es hervorragend und er freut sich seines Lebens. Regelmäßig Futter, gefahrloser Schlaf und Spazierenrennen ist seine Leidenschaft. Die Welt ist groß, die Welt ist schön und jeden Tag gibt es neue Gefilde die man, quer über das Feld davonwetzend, entdecken kann. Letzte Woche hat er einem Schrebergarten in dem gegrillt wurde, einen Besuch abgestattet, wobei er durch drei andere Gärten hindurch musste, was die Besitzer sicherlich dankbar sein lässt, weil sie jetzt wissen, wo die Löcher in ihren Zäunen sind. Vorgestern ist er durch eine viel befahrene Reihenhaussiedlung spaziert, inklusive Zeitungsladen, Sonnenstudio und Getränkemarkt. Ich wiederum stehe dann da, habe keine Ahnung wo ich ihn suchen soll, weil er wie vom Erdboden verschluckt ist und kann mir aussuchen, welche Horrorvision mir besser gefällt: dass er die Hauptverkehrsstraße erreicht und sich einbildet sie überqueren zu müssen, was pro Jahr mindestens zwei Dutzend Igeln und etlichen Katzen misslingt oder dass er einem Hobbyjäger vor die Flinte kommt, der sich freut einen waschechten Streuner abknallen zu können. Einfangen lässt sich der Kerl doch nicht, dazu ist er viel zu ausgebufft. Man kann nur da stehen, mit den Zähnen klappern oder knirschen, je nachdem, und warten bis er wieder aufkreuzt. Allerdings muss man ihm zugestehen, dass er nie länger als eine halbe Stunde verschwindet und auch nie bei Regen. So rücksichtsvoll ist er immerhin.“
„Du Arme!“ sagte Annett lind. „Was für ein Lamento!“
„Ach ja?“ entgegnete ich erzürnt. „Dann lass’ mich hinzufügen, dass er heute Harakiri machen wollte und dass wir einen Mordsdussel hatten, nicht alle beide plattgefahren worden zu sein!“
„Ups!“ machte sie. „Wie das?“
„Wie? Indem er abgehauen ist, natürlich! Erst lief alles super und ich dachte schon, wir haben es endlich hingekriegt. Ich hab mir angewöhnt, ihn an einem ganz bestimmten Punkt von der Leine zu lassen. Danach kann er erstmal rennen, was er auch ausgiebig tut. An einem weiteren ganz bestimmten Punkt bleibe ich dann einfach solange stehen, bis er zu mir kommt. Dann wird er belohnt und kommt wieder an die Leine. Und so weiter, bis wir in die Gegend kommen wo es kritisch wird, weil da Gärten sind und denen kann er nicht widerstehen. Da muss er an die Leine, was immer eine Zitterpartie ist, weil ich nie genau weiß, wann er zu weit weg ist. Wenn eine bestimmte Entfernung überschritten wird gehorcht er nicht mehr, sondern rennt einfach weiter seiner verdammten schwarzen Nase hinterher. Und so war’s heute. Ich bleibe stehen und rufe ihn und er bleibt auch stehen und guckt zurück und ich konnte genau sehen, wie er die Entfernung ausgemessen hat. Und dann macht er kehrt, wedelt zum Abschied und weg ist er. Und ist er erstmal weg nutzt dir allenfalls noch ein Segelflieger oder ein Heißluftballon mit Radar, denn zu allen anderen Übeln hat er anscheinend auch noch die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen! Ich bin wie wild mit dem Fahrrad durch die Gegend, hab Hinz und Kunz gefragt ob jemand einen kleinen, schwarzen, krummbeinigen, verfluchten Straßenköter gesehen hat – nichts! Absolut nichts! Mittlerweile war ich an der Straße – weißt du was sich da abspielt? Da fährt jeder wie auf dem Nürburgring und es ist so laut, dass du die Passanten anbrüllen musst, damit sie dich hören. Und da sehe ich ihn, weit vorne, ganz gemütlich, schnuppert hier, schnuppert da, hebt das Bein, ganz souverän. Und wie ich schon nah genug bin, dass er mich hören kann, da wird der Rottweiler vom Grundstück auf der anderen Straßenseite mobil und erklärt ihm den Krieg und hastdunichtgesehen stürzt sich dieses idiotische Vieh auf die Straße, weil er meint, er muss dem Rotti die Meinung geigen, und natürlich erwischt er genau die notwendigen anderthalb Meter zwischen zwei Autos um heil durchzukommen, und ich kriege einen Blackout, schmeiße das Fahrrad hin, schreie ,Robbiiiiieeeee’, und rase hinterher, auch wieder zwischen zwei Autos. Die beiden Tölen beschimpfen sich nach Herzenslust, dadurch hat er nicht mitgekriegt, dass ich an ihm dran war, erst als ich ihn am Halsband hatte und die Leine über seinen Hintern gezogen hab, da kam er zu sich und wurde ganz schlaff vor Schreck. Und dann kommt der Rotti-Besitzer und will wissen, warum ich den armen Hund verprügele und ob ich ihn nicht anders erziehen könne als mit Gewalt! Ich war so tobsüchtig, ich hätte ihm sein Haus samt Hundehütte abfackeln können! Und gegenüber brüllt so ein dämlicher Autofahrer ich soll gefälligst das Fahrrad aus der Einfahrt entfernen, weil er raus will oder rein, oder was weiß ich! Ich schwöre dir, hätte ich in diesem Moment den Hund nach Bulgarien zurückbeamen können, er hätte sich sofort in seine Moleküle aufgelöst! Das war ein ganz bezaubernder Tag!“
„Au Backe!“ meinte Annett mitfühlend. „Das hätte aber ins Auge gehen können. Da rufe ich ja wohl gerade richtig an. Ich hab vielleicht was für ihn.“
Ich fuhr kerzengrade in die Höhe.
„Du hast was...Mädel, sprich! Was? Wo? Wer?“
„Unsere Lucy ist zurückgekommen Wir haben sie vor einem Jahr an ganz freundliche Leute vermittelt, aber sie hat sich einfach nicht eingewöhnt. Ich muss dazu sagen, dass wir Lucy aus einem anderen Tierheim bekommen haben – vielleicht hast du davon gehört, war ein Riesenskandal, die Tiere wurden da regelrecht massakriert – und Lucy war eine der Überlebenden. Sie war extrem misstrauisch und verängstigt und wahrscheinlich haben wir sie zu früh neu vermittelt. Aber die Leute wollten es wirklich versuchen, da haben wir es eben auch versucht. Aber es ging nicht. Die haben ein großes Grundstück und Lucy hat immer einen Weg gefunden auszubrechen, hat sich nicht anfassen lassen, wollte nicht ins Haus. Und gestern hat man sie zurück gebracht. Und da dachten wir an Robbie. Die Leute wollen wirklich gerne einen Hund haben und wie gesagt, die haben ein Riesengrundstück und eine Oma, die tagsüber viel alleine ist und einen Beschützer braucht. Es ist mitten auf dem Land, links und rechts nur Gegend und ein paar Häuser. Wie gesagt, es könnte was für ihn sein. Hast du Zeit mitzukommen und es dir anzusehen?“
„Ob ich Zeit... selbst wenn ich keine hätte, das ist der erste Lichtblick seit Wochen und es hört sich super an!“
Annett versprach einen Termin auszumachen und sich zu melden.
Ich blickte Robbie an.
„Junge“, sagte ich, „großes Gelände mit ganz viel Zaun zum Markieren! Und eine nette Oma als Aufgabe! Das wär’s doch, oder?“
Er schaute mich mit seinen intelligenten Augen an, so als sei er bereit, ausnahmslos alles was ich wollte großartig zu finden, ausgenommen Leinenzwang und ich dachte, dass er ein einzigartig wunderbarer, origineller und bemerkenswerter Hund sei.
Und dann wusste ich, dass er mir entsetzlich fehlen würde.

In dieser Nacht hörte ich ihn weinen.
Ich wurde wach, weil Klagelaute in meinen Schlaf eindrangen und setzte mich auf, als mir klar wurde, dass ich nicht träumte. Das Gejammer kam von oben, also musste es Robbie sein, denn Sisi und Lise lagen zusammengerollt auf ihren Kissen neben meinem Bett und schliefen selig. Ich ging leise die Treppe hoch und sah ihn auf dem Teppich liegen, den Körper von konvulsivischen Erschütterungen bebend, mit den krummen Vorderläufen hektisch paddelnd, während wimmernde Jammertöne der geöffneten Schnauze entflohen. Aber er schlief, wurde auch nicht wach als ich herankam und mich zu ihm hockte, unschlüssig, ob ich ihn wecken sollte oder nicht. Ich legte sacht meine Hand auf seinen Bauch, der wie ein Blasebalg bebte und spürte nach einiger Zeit, dass die Zuckungen nachließen und er ruhiger atmete. Auch das Wimmern wurde leiser und verstummte schließlich. Aber er wachte nicht auf. Er war tief in einem Elend gefangen in das ihm niemand folgen konnte, noch auch nur wünschen würde, es tun zu können. Ich hatte schon erlebt, wenn Sisi träumte; sie schien dann immer erfolglos Katzen zu jagen und es war spaßig mitanzusehen, wie sie fiepte und winselte, mit den Pfoten ruderte und wie wild die Rute schlug.
Dies hier war nicht spaßig.
Dies hier war Leid.
Es war erlebtes, erlittenes Leid, das nur so und nicht anders, wenn überhaupt, bewältigt werden konnte.

„Das ist Klein-Bulgarien!“ entfährt es mir, als ich durch das Tor spähe, Robbie an der Leine, Annett neben mir. Die Ähnlichkeiten sind nicht zu leugnen. Das Haus hat seine besten Jahre ebenso hinter sich wie die große Scheune; hinten befindet sich eine Baustelle und überall stehen Gerätschaften herum, die nicht so aussehen als wären sie noch in Benutzung. Der Gehweg zum Haus wurde offensichtlich vor langer Zeit aus Beton gegossen und zeigt interessante Risse; links und rechts daneben kämpfen Blumenrabatten ums Überleben und ein uralter, knorriger Rosenstrauch klammert sich energisch an einem klapprigen Gerüst fest, dabei offen lassend, wer hier eigentlich wen stützt. Durch das geöffnete Scheunentor sausen Schwalben ein und aus und in den alten, verwitterten Bäumen hängen viele Nistkästen, während sich in wild wuchernden Hecken etliche Spatzenclans prügeln.
Aber der Zaun, der sich weit um das große Gelände erstreckt, sieht stabil aus.
„Himmlisch!“ murmele ich verzückt. „Ach Robbie! Robbielein, du bist zu Hause!“
Er beäugt mich skeptisch, als wolle er mitteilen, dass er zwar in einer zivilisierten Großstadt gelebt habe und nicht in einer Kolchose, aber selbstredend wie immer bereit sei meinen Vorstellungen zu folgen, wie idiotisch sie auch immer sein mögen.
„Das ist einfach großartig!“ Ich lasse meinen Blick schweifen und finde, wie Annett gesagt hat, nichts als Gegend. Gegenüber befindet sich ein anderes Gehöft, in unzweifelhaft gepflegterem Zustand und bewacht von einer Schäferhund-Edeldame, die senkrecht am Zaun steht und eine Flut unwiederholbarer Beschimpfungen der adligen Schnauze entrinnen und auf den Eindringling, den sie offenbar sofort als minderes Subjekt identifiziert hat, regnen lässt. Robbies Rute, neben seinem beeindruckenden Haupt sein imposantestes Teil, ragt steil in die Höhe, während er der Dame souverän, aber nicht gänzlich uninteressiert, den Hintern zuwendet, das Bein hebt und seine erste Markierung ans Tor setzt.
So!
Vom Haus naht ein Empfangskomitee, allen voran die achtzigjährige Oma, schwerhörig zwar, aber gut zu Fuß, gefolgt von Sohn und Tochter, beide in mittlerem Alter, während hinten von der Baustelle neugierige Köpfe ragen, den erwarteten Vierbeiner und seine Eskorte in Augenschein nehmend.
Eingelassen und feststellend, das dass Tor hinter ihm wieder geschlossen wurde, setzt sich Robbie auf die Hinterläufe, lässt die Zunge heraushängen und wartet höflich ab, wie die Begutachtung seiner Person ausfallen wird.
„Der ist ja doch ziemlich groß!“ bemerkt die Tochter.
„Dreißig Zentimeter Schulterhöhe!“ sagt Annett. „Damit gehört er eindeutig zu den Kleinwüchsigen. Er ist nur etwas wuchtig, aber wenn Sie einen Wachhund wollen kann das nicht verkehrt sein. Er wird etwaige Galgenvögel sicherlich eher beeindrucken als ein Zwergspitz!“
„Der ist schon richtig“, sagt der Sohn und betrachtet ihn nachdenklich. „Wir wollen doch keinen Schoßhund.“
Diese Bemerkung findet offenbar Robbies Zustimmung, denn er erhebt sich, trabt auf seinen Fürsprecher zu und richtet sich an ihm auf, freundlich die Rute schwenkend.
,Er gefällt ihm,’ denke ich, an aufsteigenden Tränen würgend. ,Bei allen Heiligen und St.Franz vorneweg, er mag ihn! Gott, ich danke dir! Gib’ dass sie ihn auch mögen, gib’ dass sie erkennen, was für ein großartiger Hund er ist!’
Sie schauen sich an, Mann und Hund und ich hoffe dass unmerklich ein Band geknüpft wird, dass aus ihnen Herr und Hund machen wird. Der Mann krault des Hundes Kopf und zupft spielerisch an seinen Flatterohren und der Hund zieht die Lefzen zurück und grinst. Dann fällt er auf seine vier krummen Beine zurück, wedelt einmal in die Runde und beginnt unverzüglich sein neues Revier in Augenschein zu nehmen, was er damit krönt, dass er unter einem, um seine Existenz ringenden, Rhododendron einen respektablen Haufen setzt.
Die Oma sagt: „Also von mir aus kann er bleiben,“ und die anderen nicken zustimmend und die Tochter fragt: „Was frisst er?“ und Annett erwidert: „Alles was ihn nicht zuerst frisst!“ was alle befriedigt, und ich sage verstört: „Was denn, gleich heute, jetzt?“ und Annett pufft mich in die Seite und ich verstumme und frage mich, ob ich es jemals schaffen werde, ein Geschöpf, das ich mir vertraut gemacht habe, leichten Herzens loszulassen.
„Er wird aber doch im Haus gehalten?“ frage ich.
„Natürlich!“ antworten sie.
„Und er wird nie, niemals an die Kette gelegt oder in einen Zwinger gesperrt?“
„Natürlich nicht!“
„Das werden Sie unterschreiben müssen, das wissen Sie?“
„Natürlich!“
„Und er wird niemals an Fremde weggegeben, sondern kommt notfalls zu mir zurück!“
„Er wird nicht weg gegeben“, sagt Robbies Herr. „Er wird hier alt werden.“
Ich blinzele ein paar Tränen weg und schniefe undeutlich: „Danke. Dann ist alles in Ordnung.“
Robbie kommt um die Scheune herumgefegt, ein Ohr hochgeklappt, das andere verwegen flatternd, die Zunge lang hängend, bremst kurz ab, macht kehrt, wetzt in die andere Richtung weiter und taucht erst wieder auf, als wir, nach Erledigung aller Formalitäten, zum Gehen bereit sind.
Er begleitet uns zum Tor und wirkt einen Augenblick ratlos, als er versteht, dass wir ohne ihn gehen wollen.
Abschied? Wieder einmal?
Wie viel Abschied hat er schon erlebt und hingenommen? Wie oft ist er verlassen worden und hat, auf den Hinterläufen sitzend, stumm den Scheidenden nachgesehen, um sich aufs Neue mit einer Situation abzufinden, die er nicht ändern konnte, nur aushalten musste, in unruhigem Schlaf und nächtlichem Weinen?
Seine wissenden und plötzlich uralten Augen schauen mich an.
Du gehst auch wieder?
Ich muss gehen, Robbie.
Und ich muss bleiben?
Du musst bleiben.
Kannst du nicht auch bleiben?
Ich gehöre nicht hierher, Robbie.
Und wohin gehöre ich, wenn nicht zu dir?
Du gehörst hierher, mein Kleiner. Du bist jetzt zu Hause.
Ich dachte, ich bin da zu Hause, wo du bist.
Du bist jetzt hier zu Hause. Zumindest wirst du es bald sein.
Ich dachte, ich bin da zu Hause, wo du bist.
Du bist da zu Hause wo dein Herr ist.
Da kommt sein Herr und hält eine Wurst in der Hand und eine Wurst ist so gut wie ein Zuhause, jedenfalls wenn die Aussicht auf noch mehr Würste in so verheißungsvolle Nähe rückt, und Robbie schnappt sich die Wurst und macht sich auf die Suche nach einem Ort, wo er den Leckerbissen entweder verspeisen oder vergraben kann...

...und ich schlüpfe durch das Tor und werfe den Motor an, wie auf der Flucht.
Im Wegfahren schaue ich in den Rückspiegel und sehe ihn am Zaun sitzen und hinter mir her schauen; auf den Hinterläufen, mit langer und wahrscheinlich tropfender Zunge.
Wohin gehen wir? Nach Hause, immer nach Hause?
Und wo ist dieses Zuhause, wenn nicht da, wo wir geliebt werden?

Spätsommer 2007
„Er wird nicht weg gegeben“, hatte Robbies Herr gesagt. „Er wird hier alt werden.“
Weggegeben wurde er nicht.
Nur hinausgeworfen.
Und er war alt geworden, an diesem Platz, den ich für sein endgültiges Zuhause gehalten hatte. Fünf Jahre hatte er dort gelebt, das Haus, das Anwesen und die Oma bewacht; und solange sie lebte ging es ihm gut – wenn man davon absieht dass seinem Laufbedürfnis wohl nicht übermäßig viel Aufmerksamkeit gezollt, sondern davon ausgegangen worden war, dass er schließlich ein ausreichend großes Gelände zum Herumlaufen hatte.
Er hatte nicht an der Kette gelegen und er war auch nie in einem Zwinger eingesperrt worden; und das ist in einem Bundesland, wo der Begriff „Dorfstraße“ bei jedem Tierschützer die Alarmglocken scheppern lässt, weil „Dorfstraße“ allzu häufig als Synonym für „Kettenhaltung“ anzusehen ist, schon viel. Und Robbie war nie anspruchsvoll gewesen. Er hatte sein sicheres Zuhause und die spröde Zuneigung der alten Frau zu schätzen gewusst, denn es war mehr als er jemals gehabt hatte.
Die Oma starb im Sommer 07, nachdem sie über ein Jahr in einem Pflegeheim zugebracht hatte. Solange sie lebte war er sicher, denn sie bestand darauf ihn bei den wöchentlichen Besuchen des Sohnes zu sehen. Er musste ihn mitbringen.
Als sie starb gab es diese Verpflichtung nicht mehr. Und offenbar auch keine andere dem Hund gegenüber, der fünf Jahre lang auf dem Hof zu Hause gewesen und dort grau geworden war.
Ende August 07 wurde Robbie von Ordnungskräften auf der Straße, weit weg von diesem Zuhause, aufgegriffen und zurück nach Märkisch Buchholz gebracht. Zum Glück war er nicht aus diesem Einzugsbereich entfernt gefunden und einem anderen Tierheim überantwortet worden, wo niemand etwas von ihm gewusst hätte. Hier wusste man wo er untergebracht gewesen war und benachrichtigte den „Besitzer“. Der erschien, erklärte der Hund sei entlaufen und er wolle ihn nicht zurück. Basta. Wie Robbie nach fünf Jahren, selbst wenn er einen eigenmächtigen „Spaziergang“ unternommen hätte, sich so weit von seinem Hof hätte entfernen können, dass er – (der sich immerhin in seinen Jugendjahren in einer Großstadt zurecht gefunden hatte) - offenbar nicht in der Lage gewesen war allein zurück zu finden, wurde nicht geklärt und vielleicht auch nicht erfragt. Warum auch? Man hatte im Tierheim genug Erfahrung um zu wissen, was von solchem Gebaren zu halten und dass der Hund bei diesem Menschen sicher nicht mehr gut aufgehoben war.
Ich erfuhr erst zwei Monate später davon, als mich ehemalige Nachbarn, die sein Foto in der Bezirkszeitung gesehen und ihn sofort erkannt hatten, anriefen. Und diesmal war ich nicht imstande ihn herauszuholen, hatte sogar erst Wochen später die Möglichkeit ihn zu besuchen. Sein Kummer sprang mich förmlich an, obgleich er sich schon weitestgehend beruhigt hatte, wie mir gesagt wurde; am Anfang seiner Gefangenschaft hatte er voller Verzweiflung den Zwinger zerlegt. Er freute sich so unbändig mich zu sehen - und ich konnte nichts weiter tun, als Unmengen Fotos von ihm zu schießen und ihn zumindest an diesem Tag ausgiebig Gassi zu führen.
Als ich ging saß er am Zaun seines Zwingers und sah mir nach – wie schon so oft. Ich hatte ihm nur versprechen können alles zu tun was mir möglich war um noch einmal ein Zuhause für ihn zu finden – und ich wusste genau wie klein die Chancen dafür waren.
Er, der immer mehr Charakter als Schönheit besessen hatte, war nun neun oder zehn Jahre alt, klein, krummbeinig, grauschnäuzig, und alles andere als fotogen. Sein liebenswertes Wesen konnte nur schwer über ein Foto transportiert werden; es war schon damals nicht einfach gewesen ihn zu fotografieren, weil außer einem großen schwarzen Fleck – er – und einem kleinen roten Fleck – seine Zunge – kaum etwas zu erkennen war. Inzwischen war die Farbe um den roten Fleck herum ziemlich grauweiß gesprenkelt, was aber nur sein fortgeschrittenes Alter erkennen ließ und auch nicht gerade vermittlungsfördernd wirkte.
Ich schickte ihn über sämtliche Internet-Tierschutzverteiler-und-foren, und setzte ihn auf alle entsprechenden Internetseiten, wo er das Schicksal hunderter anderer Graubärte teilte, die mit herzzerreißend ernsten und kummervollen Gesichtern in eine Welt schauten die ihnen keinen Platz mehr in ihrer Gemeinschaft einräumte, die sie ausgestoßen hatte, aus Gründen die ebenso fadenscheinig wie unbarmherzig waren.
Sie alle brauchten ein Wunder, ich aber suchte nur nach einem einzigen: für einen kleinen, alten, krummbeinigen Streuner, der vor vielen Jahren in einer Hafenstadt am Schwarzen Meer geboren und durch das Schicksal, in Person einer kleinen, alten, wenn auch nicht krummbeinigen, Frau mit großem Herzen, hierher in ein fremdes Land, befördert worden war.
Ich brauchte ein Wunder für mein altes Robbelchen.

Jahresanfang 2008
Suse hieß eigentlich Olga – zumindest wenn es nach mir gegangen wäre – und hatte ihre Jugendjahre, die allerdings noch nicht ganz so lange wie die Robbies zurücklagen, ebenfalls in jener Hafenstadt in Bulgarien verbracht. Sie hatte zweimal eine Tötungsstation von innen gesehen und schließlich Asyl in der Tierstation Dobrich, 50 km vom Schwarzen Meer entfernt, gefunden, dem sie allerdings, bis auf die Tatsache regelmäßiger Futterzufuhr, nichts Positives abgewinnen konnte. Diesem einen Pluspunkt sprach sie bis zu Platzen zu, und da ihrem aktiven Geist so wenig Anregung geboten wurde wie ihrem – ursprünglich an lange Wanderungen gewöhnten – langezogenen Dackelmixkörper, zeigten sich bald die negativen Begleiterscheinungen eines sesshaften Daseins. Olga-Suse wurde rund und immer runder. Ihre Gemütslage dagegen entsprach in etwa der einer wehrhaften Amazone und war alles andere als jovial, wie einlullend gemütlich sie auch aussehen mochte.
Sie kam zum Jahresanfang 2006 nach Deutschland und fand für die nächsten anderthalb Jahre Aufnahme in einer Pflegestelle, wo sie endgültig zu „Suse“ wurde, und noch so einige Pfündchen zulegte, sodass sie schließlich, als ihr endlich, im September 2007, das Vermittlungsglück winkte, ein wenig wie ein Rollbraten aussah – wenn auch einer mit scharfen Zähnen.
Die Berichte über Suses glückliches Zuhause ließen mich neidvoll seufzen und meinem armen Robbie einen ähnlichen Lottogewinn wünschen.
Zunächst.
Dann kam – begleitet von weiteren Seufzern, die Erkenntnis, dass auch Suse – nach allgemein gültigen Maßstäben jedenfalls – nicht als der Prototyp eines besonders herzigen Hundes anzusehen war und dass sie immerhin mehr als 18 Monate auf ihr Glück hatte warten müssen – wenn auch Gottlob nicht hinter Zwingergittern.
Aber Suse war nicht zehn Jahre alt.
Rein rechnerisch hatte Robbie weitaus weniger Zeit zu verwarten.
Darauf dauerte es dann nicht mehr allzu lange, bis mir einfiel, dass Fragen schließlich nichts kostet – und die Frage um die es ging sollte lauten, ob man es sich vielleicht vorstellen könnte, einen zweiten, vom Schicksal hart gebeutelten, bulgarischen Vierbeiner in die Familie aufzunehmen?
Bis besagte Frage von mir an Suses ehemalige Patin, über Suses ehemalige Pflegemutter an die korrekte Adresse gerichtet wurde, verging einige Zeit.
Dafür lautete die Antwort – hoffnungsträchtig auf meinem Anrufbeantworter summend - Knall und Fall „Ja“ – immer vorausgesetzt Suse war einverstanden.
Ich vergaß meine Abneigung gegen Telefonate mit unbekannten Personen und hängte mich sofort an den Hörer, zappelig vor Aufregung, dass das Schicksal, dieses unberechenbarste Element der Schöpfung, doch noch einmal einen Blumenkranz aus seinem Füllhorn in Robbies Richtung geworfen hatte.
Ja, die Familie wollte ihn haben. Ja, sie wollten ihn so schnell wie möglich holen. Nein, er sollte keinen Tag länger als notwendig im Tierheim sitzen.
„Er ist ein ganz, ganz Lieber!“ sagte ich heftig schnüffelnd. „Aber er ist ein Läufer. Egal wie alt, egal wie krummbeinig – er rennt. Kilometerweit wenn’s drauf ankommt. Immer noch. Wie fit sind Sie?“
Diese Aussage setzte seinen Chancen noch einen gehörigen Pluspunkt auf, denn Suse Rollbraten war den langen Wanderungen der Familie überaus abgeneigt und man hegte die Hoffnung, dass ein lauffreudiger Kumpel der Dame Beine zu machen imstande sein könnte.
Vorausgesetzt sie war einverstanden...
Nach allem was ich von Suse wusste konnte diese Doktrin als ernstzunehmendes Hindernis angesehen werden, dennoch erschien mir die Entschlossenheit der Familie, die mir da durch den Hörer entgegenkam ausreichend zu sein, um Suse zu überzeugen – jedenfalls wurde ein Termin festgelegt – nämlich der 2.Februar 2008 – an dem man, samt Suse im Fond – aus dem fernen Stade nach Brandenburg reisen wollte, um einen alten schwarzen bulgarischen Vierbeiner aus seinem Zwinger zu befreien und in ein endgültiges Zuhause zu bringen.
Märkisch Buchholz wurde informiert und erklärte sich, angesichts der Entfernung –(und meiner Beredsamkeit) - bereit, von der mindestens zweimaligen Besuchspflicht abzurücken, und von der Hundetauglichkeit der Interessenten auszugehen, zumal für eine Nachkontrolle auf jeden Fall gesorgt war.
Not kennt kein Gebot; ich hatte bereits im Dezember eine Tierkommunikatorin gebeten Robbie zu kontaktieren und ihn, wenn möglich, zu beruhigen und seelisch aufzubauen. Sie hatte allerdings meine Einschätzung bestätigt, dass schnellstens eine Lösung gefunden werden musste.
„... keiner hat eben Zeit, ich bin satt und versorgt, ich werde gut behandelt, es ist nicht so schlecht, nur mir tut es eben weh... ich habe Angst, immer hier bleiben zu müssen, ich bin gerne dabei, neben jemandem, oder dahinter, aber nicht gerne alleine, ich bin lange genug in meinem Leben alleine gewesen, man kann sich daran gewöhnen, viele tun dies, für mich wäre es mein letzter Gang, an dies kann ich mich nicht gewöhnen... es ist so eine Unruhe in mir drinnen, die tut weh, ganz tief in mir drin tut es sehr weh...“
Das hatte er „gesagt“. Und es hatte mich fix und fertig gemacht.
Ich wusste dass er gut behandelt wurde. Und ich wusste auch, dass niemand wirklich Zeit für ihn haben konnte. Und ich wusste was er hinter sich hatte.
Aber ich hatte nicht gewusst wie sehr er in all diesen Jahren, in denen ich ihn gut untergebracht geglaubt hatte, allein gewesen sein musste.
Diese Chance, die sich jetzt hier bot, war sehr wahrscheinlich seine letzte, und wenn sie von Suse abhing dann musste Suse bearbeitet werden.
Gabi, Suses ehemalige Pflegemutter, hatte ebenfalls Kontakt zu einer Tierkommunikatorin – und nun wurde mit Suse „telefoniert“.
Das Resultat war erstaunlich. Suse hatte nichts gegen einen Kumpel. Im Gegenteil. Als ehemalige Streunerin mit einem Rudel treu ergebener Vasallen am Schwanz, war sie sogar ausgesprochen angetan von der Idee wieder mit jemandem ihresgleichen zusammenleben zu können. Allerdings: sie wollte ihr eigenes Körbchen; und sie wollte ihren eigenen Fressnapf. Völlig akzeptabel.
Und sie wollte ein rotes Halsband und der Neue sollte ein grünes haben.
Dazu muss man sagen, dass Hunde nur ein beschränktes Farbspektrum wahrnehmen. Vergleichen lässt es sich mit starker rot-grün-Fehlsichtigkeit bei Menschen, das heißt ein Hund sieht Objekte, die für uns rot sind in gelb, während das grün farblos ist. Suse wollte also ganz klar ein für sie – und somit natürlich auch für jeden anderen - deutlich erkennbares Rangabzeichen, welches den „Neuen“ ebenso deutlich auf den zweiten Platz verweisen würde.
Ich war mir sicher, dass Robbie damit würde leben können. Er kannte die Gesetze der Hierarchie.
Dennoch bat ich die Tierkommunikatorin ihn vorzubereiten. Sicher ist sicher.

Exkurs:Es gibt sie wirklich, diese Menschen, die ein oder auch mehrere Lottosechser für ein paar arme, von der Menschheit gebeutelte Fellnasen sind, sie aufnehmen und über alles lieben.
Hans und Kathrin sind solche Menschen. Jeder von uns kennt welche und kann manchmal das Glück kaum fassen, wenn sich die Lottosechser tatsächlich als solche herausstellen und die ärmsten aller armen Geschöpfe Aufnahme bei ihnen finden, von ihnen gehegt, gepflegt und aufgepäppelt werden und noch einmal Wärme, Geborgenheit und Glück im Leben erfahren dürfen. Manchmal ist es nur kurz, aber es war doch zumindest da und gab noch einmal ein kleines Licht in einem ansonsten dunklen Dasein; und manchmal kann die schon verlorene Seele noch alles nach-und aufholen, um dem Leben alles abzutrotzen (oder zu schmeicheln), was es ihm bislang verwehrt hatte.
Die beiden kamen samt Suse, bezahlten die nicht unerhebliche – (und in meinen Augen anzweifelhafte) – Schutzgebühr und holte den kranken Hund, der dort nicht mehr lange überlebt hätte, nach Hause, versorgten ihn, ließen ihn behandeln, sogar operieren – und liebten ihn - einen Graubart, der Würde und Weisheit ausstrahlte – und gaben ihm das Glück der letzten Jahre.
Danke Kathrin, Hans und Lisa. (Und Suse, die ihn als Gefährten annahm)
Und danke an euch alle, die ihr einen Robbie oder eine Suse bei euch aufgenommen habt.
Danke für eure Liebe.

2.Februar 2008
Punkt 10.00 Uhr standen wir vor dem Tor von Märkisch Buchholz. Suse, die sich als liebenswertes Fellpaket herausgestellt und mich überaus freundlich begrüßt hatte, schnüffelte aufmerksam den Waldrand ab, von dem das Tierheim eingerahmt wurde. Die ersten Fellnasen innerhalb des Terrains gaben ihre – hoffnungsvollen – Begrüßungskläffer ab.
Aber sie würden alle leer ausgehen.
Bis auf einen. Hoffentlich.
Während die Interessenten sich mit Suse in Richtung des Hundeauslaufes bewegten, ließ ich Robbie aus dem Zwinger holen. Gewöhnt an seine überschwänglichen Begrüßungen sah ich verdutzt wie er mir ein freundliches Wedeln gönnte und so schnurstracks wie zielstrebig an mir vorbei zum Ausgang marschierte – zum Ausgang, nicht zum Auslauf. Der lag in der entgegengesetzten Richtung.
Ich lasse mich hängen wenn er nicht Bescheid wusste!
Ich schob ihn in die andere Richtung und wartete beklommen auf die Begrüßung der beiden, die aber so wünschenswert wie unspektakulär verlief. Suse verharrte abwartend, brummte zwar unwirsch als Robbie ihre Heckpartie beschnuppern wollte, zeigte aber keine Feindseligkeit, da dieser auch sofort zurückwich. Robbie seinerseits verhielt sich wie jemand, der um keinen Preis anecken, sondern den bestmöglichen Eindruck erwecken wollte. Meiner Ansicht nach war er sich völlig klar darüber dass es hier um eine wichtige, wenn nicht sogar seine letzte Chance ging. Die folgenden zwei Stunden wurden mit Spazierenrennen ausgefüllt, was einzig Robbie nicht aus der Puste brachte. Suse, von dem Wunsch beseelt die Nase vorn zu behalten, kämpfte sich redlich ab das kleine Krummbein – und gegen sie wirkte er tatsächlich nahezu klein – zu überholen, während Hans und Kathrin sich bemühten mit beiden Schritt zu halten.


Ich hielt mich heraus. Zum einen war mir das Marschtempo zu flott, zum anderen war ich der Meinung mein Soll in dieser Hinsicht schon vor Jahren übererfüllt zu haben, und zum dritten war dies das Feld seiner künftigen Familie. Nicht meines. Ich glaube auch nicht dass er mich vermisste.
Erst als alle im Büro saßen und die Formalitäten erledigt wurden kam er zu mir, stupste mich an und rieb seinen Kopf an meinem Knie. Ich beugte mich zu ihm, kraulte seine breite Brust, und er sah mich an. Zum letzten Mal.
So haben wir uns verabschiedet – vielleicht zum letzten Mal.
Um 11.50 Uhr saß er, zusammen mit Suse, im Fond des Kombi, völlig gelassen und selbstverständlich, mich, die ich draußen mit der Kamera herumtanzte und unbedingt noch ein Abschiedsfoto schießen wollte, mehr als nur ein wenig ignorierend. Er hatte dieses Kapitel beendet und ein neues aufgeschlagen.
Der Wagen rollte die Auffahrt hinunter und diesmal war ich diejenige die zurückblieb und hinterher schaute.
Und irgendwie tatsächlich auf den Hinterläufen sitzend, mit tropfender Zunge.
Auch wenn das niemand gesehen hat und es mehr die Augen waren, die tropften.

Glückliche Jahre und Abschied...
2009 und 2010 hatte er zwei ziemlich schwere Operationen gut überstanden und freute sich danach weiterhin seines Lebens. Er war schon im Tierheim krank gewesen – seine Bemerkung „tief in ihm drin würde es wehtun“ war also weniger metaphorisch gemeint gewesen als mir klar war. Er hätte dort nicht mehr lange durchgehalten.
Es war dann doch kein endgültiger Abschied, denn im Sommer 09 habe ich ihn besucht und konnte sehen wie glücklich er war – und dass seine Familie sich Arme und Beine für ihn und Suse ausriss. Suse hatte sich ja mit seiner Existenz zunächst nur abgefunden; aber irgendwann hatte sie ihn dann doch als Gefährten akzeptiert.
Und wenn sie mich gefragt hätte (was sie nicht tat) – es gab niemanden der ähnlich gut zu ihr hätte passen können als der, dessen Leben ähnlich verlaufen war wie das ihre, der ein gleiches Schicksal geteilt hatte und nun das Glück der späten Jahre mit ihr teilte – ein Glück, dass sie beide verdient hatten.
Aber dass mein altes schwarzes Krummbein es noch einmal erfahren durfte, treibt mir auch heute noch das Wasser in die Augen… und lässt mich demütig dankbar sein.
Im Herbst 2013 sah ich ihn zum letzten Mal und ich wusste es.
Er war deutlich alt geworden, hielt aber das Leben eisern fest. Es war ihm zu kostbar.
Dass Suse vor ihm gehen würde hätte ich nie gedacht, denn Robbie war nicht nur älter, sondern eben auch keinesfalls gesund.
Aber im März 2015 kam die Nachricht dass Krebs sie besiegt hatte – sie, die so unbesiegbar schien. Im Februar schon, aber weder Hans noch Kathrin waren in der Lage gewesen es mir zu sagen. Es hatte sie zu tief getroffen.
Kurz darauf rief sie Robbie zu sich, ihren Gefährten der letzten, glücklichen Jahre, mit dem sie nicht nur eine gemeinsame Herkunft sondern auch ein ähnliches Schicksal verbunden hatte.
Vielleicht war es ihr zu langweilig ohne ihn. Am 3.Mai 2015 ging er zu ihr.
Adieu, ihr beiden. Dort drüben sind 1000 Jahre nur wie ein Tag und dann werdet ihr die wiedersehen, die euch immer lieben werden.
Auch mich.

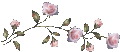

Es wird aussehen, als wäre ich tot,
und das wird nicht wahr sein...
Und wenn du dich getröstet hast,
wirst du froh sein, mich gekannt zu haben.
Du wirst immer mein Freund sein.
Antoine de Saint-Exupéry
Du warst mein Freund und wirst es immer sein.









